Anforderungen an Website-Prototypen (webinale, Berlin)
Vortrag vom 23. Mai 2007 (↻ 23. September 2022), exklusiv für die webinale, Berlin (nicht gehalten). Schwerpunkt: Webentwicklung (RSS-Feed für alle Themen).
Dieser und viele andere Beiträge sind auch als hübsches, wohlerzogenes E-Book erhältlich: On Web Development.
Inhalt
Definitionen
- Prototyp:
-
Eine projektbezogene Sammlung von statischen oder dynamischen Vorlagen basierend auf HTML, CSS und DOM-Scripting.
Ein Mikrokosmos Ihrer Online-Investition.
Entsprechend vor allem der ersten Definition sind im Folgenden Faktoren wie technische Basis, Informationsarchitektur oder Qualitätssicherung – durch zum Beispiel automatisierte Tests – von Prototypen nicht relevant.
Problem
Schlechte (und erst recht non-existente) Prototypen kosten Geld.
Anforderungen
Universalität
Alles abbilden, das auch live ist.
Das »Was«, auf Seitentypen und -elemente bezogen.
Aktualität
Alles abbilden, das auch live ist.
Das »Wie«, auf Änderungen und Neuerungen auf der Live-Website bezogen.
Realismus
- Realistische Schlüsselwörter und realistischen Mikrocontent verwenden.
- Verschiedene Anwendungsfälle abbilden.
Aber: Blindtext ist okay.
Der Einsatz von realem Mikrocontent bedeutet eine wahrscheinlichere Berücksichtigung konzeptioneller Aspekte sowie ein geringeres Risiko von »Implementierungsverlusten«. Die verschiedenen Anwendungsfälle dienen der Sicherstellung der visuellen Integrität – funktionieren bestimmte Teaser-Konstellationen, passt die Zeilenhöhe bei langen Listeneinträgen und so weiter.
Fokus
Einfach halten, Redundanzen möglichst meiden.
Erklärtes Ziel: Ein Prototyp soll nicht zur Live-Website »verkommen«.
Zugänglichkeit
Breites Publikum vorsehen:
- Entwickler (zum Entwickeln/Testen),
- Projektmanager (zur internen Inspektion),
- Kunden (zur externen Inspektion),
- Benutzer (für Usability-Tests).
Während Web- und Softwareentwickler logischerweise immer zur Zielgruppe von Prototypen gehören, werden andere Gruppen in der Praxis gerne vernachlässigt. Dies entspricht ungenutztem Potential und letztlich auch herausgeschmissenem Geld. Wichtig bei der »Benutzer«-Gruppe – hier verändern sich die Anforderungen ein wenig, da diese in der Regel mehr Realismus und weniger Fokus erfordert.
Verfügbarkeit
Fixe URL vorsehen, um:
- fortlaufende Verwendung zu ermöglichen,
- Wichtigkeit des Prototypen zu unterstreichen.
… was mit lokalen und temporären Prototypinstallationen nicht möglich ist.
Verbindlichkeit
- Erfordernisse und Änderungen im Prototyp bedeuten Änderungen in der Implementierung, also der Live-Website.
- Erfordernisse und Änderungen in der Implementierung bedeuten Änderungen im Prototyp.
In der Regel beobachtet man eine Verschiebung, sobald eine auf einem Prototypen aufbauende Website ins Netz geht – während vor Launch der Prototyp maßgebend war, können nach Launch erfolgte Änderungen der Live-Website Anpassungen am Prototypen induzieren. Drift ist zu vermeiden.
Kontinuität
Fortlaufende Wartung, auch nach Projektabschluss.
Möglicher Hauptgewinn: Der nächste Relaunch ist nur ein Redesign.
Kommunikation
Änderungen kommunizieren, egal ob prototyp- oder implementierungsbezogen.
… logischerweise, durch die vorhergehenden Erfordernisse impliziert.
Dokumentation
Dokumentieren von Designprinzipien und Charakteristika (Module, Constraints, Fallstricke).
Auch wenn ein guter, funktionierender Prototyp noch nie an fehlender Dokumentation gestorben ist, ist dies dennoch ein obligatorischer Punkt.
Nachteile
Ein guter Prototyp erfordert:
- Disziplin.
Vorteile
Ein guter Prototyp bedeutet:
- Leichtere und weniger missverständliche Entwicklung.
- Leichteres Testen.
- Leichtere Wartung.
- Bessere Vorzeigbarkeit.
… und dadurch:
- Bessere Qualität,
- geringere Kosten,
- mehr Spaß.
»Mehr Spaß« durch die wesentlich unwahrscheinlichere Frustration, die auftritt, wenn Web- und Softwareentwickler Fehler beheben müssen, die aufgrund abweichender Implementierung entstanden sind – unerheblich, ob unsorgfältig übernommen wurde oder dies jeweils legitim war, aber unkommuniziert. Wie viele »Schläfer«-Elemente gibt es mittlerweile allein auf Ihrer Website?
Checkliste
Ist der Prototyp (und das Designsystem):
- umfassend?
- aktuell?
- verfügbar, jetzt?
Über mich
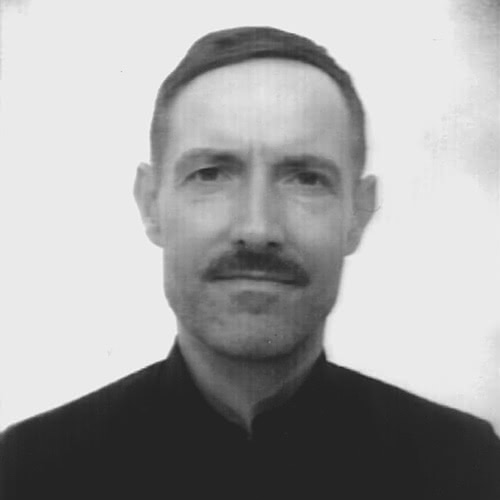
Ich bin Jens (lang: Jens Oliver Meiert), und ich bin ein Webentwickler, Manager und Autor. Ich habe als technischer Leiter und Engineering Manager für kleine und große Unternehmen gearbeitet, ich bin ein gelegentlicher Mitwirkender an Webstandards (wie HTML, CSS, WCAG) und ich schreibe und prüfe Fachbücher für O’Reilly und Frontend Dogma.
Ich experimentiere gerne, nicht nur in der Webentwicklung und im Engineering Management, sondern auch in anderen Bereichen wie der Philosophie. Hier auf meiert.com teile ich einige meiner Erfahrungen und Ansichten. (Sei jederzeit kritisch, interpretiere wohlwollend und gib Feedback.)
Ähnliche Beiträge
Das könnte dich ebenfalls interessieren:
- Prinzipien der Webentwicklung: Entwickeln Sie für was ist, nicht was sein könnte
- CSS der Zukunft
- Elemente, Tags und Attribute
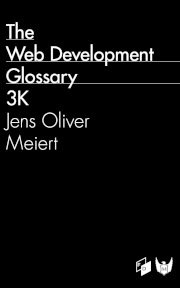
Die Webentwicklung gut überblicken? Probier WebGlossary.info – und The Web Development Glossary 3K. Mit Erklärungen und Definitionen zu tausenden Begriffen aus Webentwicklung, Webdesign und verwandten Feldern, aufbauend auf Wikipedia sowie MDN Web Docs. Erhältlich bei Apple Books, Kobo, Google Play Books und Leanpub.
