Usability-Konventionen: Grundlagen und Beispiele
Artikel vom 8. Dezember 2006, exklusiv für den Webkrauts-Adventskalender 2006. ISSN 1614-3124, #28. Schwerpunkt: Usability (RSS-Feed für alle Themen).
Dieser und viele andere Beiträge sind auch als hübsches, wohlerzogenes E-Book erhältlich: On Web Development.
Eine Konvention (v. lat.: conventio = Übereinkunft, Zusammenkunft) ist eine nicht formal festgeschriebene Regel, die von einer Gruppe von Menschen aufgrund eines Konsens eingehalten wird.
In Bezug auf Webdesign liegen neben technischen Konventionen (und Standards) unter anderem Konventionen vor, die Bedienbarkeit und Benutzerfreundlichkeit (Usability) adressieren. Sie haben ihren Ursprung in der Praxis, oftmals durch Applikationen oder andere Online-Angebote inspiriert. Größere Verbreitung von bestimmten Vorgehensweisen, wie zum Beispiel das Hervorheben oder Platzieren von Seitenelementen, sorgt gewissermaßen für Übereinkunft und damit Konvention.
Eine solche Popularität von Vorgehensweisen und Designlösungen im Webdesign muss zwar nicht unbedingt die effektivsten, effizientesten und auch angenehmsten Lösungen hervorbringen, bringt jedoch mit sich, dass Benutzer nach und nach mit diesen vertraut werden und entsprechende Erwartungen aufbauen, und besitzt den Vorteil, dass sie mit Etablierung der jeweiligen Konvention schneller und leichter zum Ziel kommen. Und so begründet sich und steigt die Wichtigkeit von Usability-Konventionen.
- Konventionen helfen Benutzern durch Erfüllung von Erwartungen.
- Konventionen unterstützen Webdesigner und -entwickler durch Vereinfachung von Entscheidungen.
Die nächsten Abschnitte beschreiben ein paar Beispielkonventionen, Erfahrungswerte und Daumenregeln, die ein Webdesigner unabhängig von allgemeiner Usability-Heuristik kennen sollte. Diese Sammlung ist recht frei gehalten und legt eine tolerante Definition von Konventionen zugrunde; eine striktere Auslegung, die beispielsweise mehr als 50% Verbreitung als Konvention und mehr als 80% als De-facto-Standard annimmt, findet sich beispielsweise bei Jakob Nielsen (1999).
Positionierung
Das im Laufe der Zeit reifer gewordene Internet hat relativ schnell Konventionen hinsichtlich der Platzierung von Seitenelementen hervorgebracht. Vom »Software Usability Research Laboratory« der Universität von Wichita (Kansas, USA) wurde bereits 2001 untersucht, wo Benutzer bestimmte Seitenelemente erwarten. Mitte 2004 und Anfang 2006 wurde die Studie nochmals durchgeführt. Die folgenden mehrheitlichen Nutzererwartungen wurden ermittelt, ohne auf die weniger deutlichen Unterschiede zwischen 2001, 2004 und 2006 einzugehen:
- Startseiten-/Homepage-Link: oben links (44%), aber auch unten Mitte (15%) und unten links (11%);
- Interne, also Navigationslinks: links;
- Seiteninterne Suche: oben;
- Werbung: oben Mitte (27%) und rechts;
- Anbieterkennzeichnung: unten Mitte, aber auch links (unten).
Links
Vor allem Jakob Nielsen propagiert in regelmäßigen Abständen Grundregeln zur Kennzeichnung von Links, die jedoch durchaus als Konventionen wahrgenommen werden können und sollten. Seine Richtlinien zur Darstellung von Links (2004) legen nahe, Links:
- farblich hervorzuheben;
- zu unterstreichen (Ausnahme: Navigationsmenüs und Linklisten, sofern klar als solche erkennbar);
- anders zu kennzeichnen, wenn sie besucht wurden;
- Nicht-Links nicht zu unterstreichen.
Ergänzung zur Unterstreichung von Links: Auch wenn Web-Usability-Experten wie Jared Spool auf die Erfahrung verweisen, dass Linkunterstreichung nicht erforderlich ist, solange Links dennoch als solche erkennbar sind, kann man Benutzern das Leben einfacher machen, wenn man eine solche alte, »native« Konvention in seiner Arbeit als Designer oder Entwickler beherzigt.
Formulare
Analog haben sich einige Konventionen für Formulare und Formularelemente herauskristallisiert.
- Buttons für Aktionen und Bestätigungen stehen links (von anderen Buttons);
- Verzicht auf »Zurücksetzen«-Buttons (okay, keine übliche Konvention);
- Formularbeschriftungen über oder links von den dazugehörigen Formularelementen (Ausnahme: Checkboxen und Radio-Buttons mit rechtsstehenden Beschriftungen).
Schlussbemerkung
Auch wenn die Definition einer Konvention hier lax erfolgt, sollte dennoch deutlich werden, warum Konventionen hilfreich sind, und gleichzeitig, welche zu den anerkannteren im Webdesign gehören. Gegenbeispiele finden sich in großer Zahl; eine populäre Plattform für viele Konventionsbrüche ist immer noch Flash, das nicht nur im Jahr 2000 zu vielen kontraproduktiven Designabweichungen führte, hauptsächlich in Bezug auf Standardinteraktionselemente (Formularelemente und Scrollbalken). Konventionen sind unsere Freunde.
Über mich
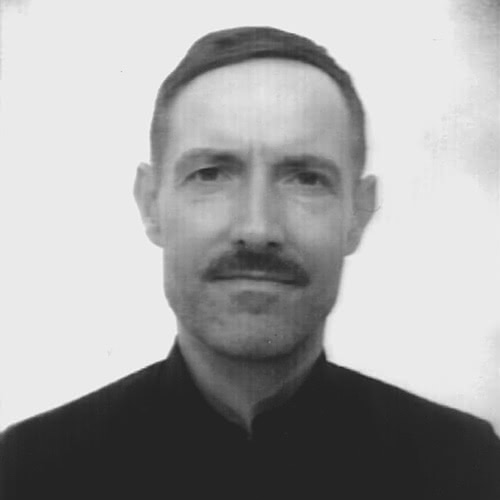
Ich bin Jens (lang: Jens Oliver Meiert), und ich bin ein Webentwickler, Manager und Autor. Ich habe als technischer Leiter und Engineering Manager für kleine und große Unternehmen gearbeitet, ich bin ein gelegentlicher Mitwirkender an Webstandards (wie HTML, CSS, WCAG) und ich schreibe und prüfe Fachbücher für O’Reilly und Frontend Dogma.
Ich experimentiere gerne, nicht nur in der Webentwicklung und im Engineering Management, sondern auch in anderen Bereichen wie der Philosophie. Hier auf meiert.com teile ich einige meiner Erfahrungen und Ansichten. (Sei jederzeit kritisch, interpretiere wohlwollend und gib Feedback.)
Ähnliche Beiträge
Das könnte dich ebenfalls interessieren:
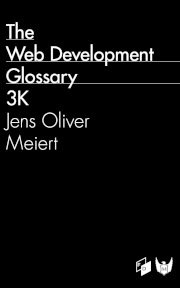
Die Webentwicklung gut überblicken? Probier WebGlossary.info – und The Web Development Glossary 3K. Mit Erklärungen und Definitionen zu tausenden Begriffen aus Webentwicklung, Webdesign und verwandten Feldern, aufbauend auf Wikipedia sowie MDN Web Docs. Erhältlich bei Apple Books, Kobo, Google Play Books und Leanpub.
